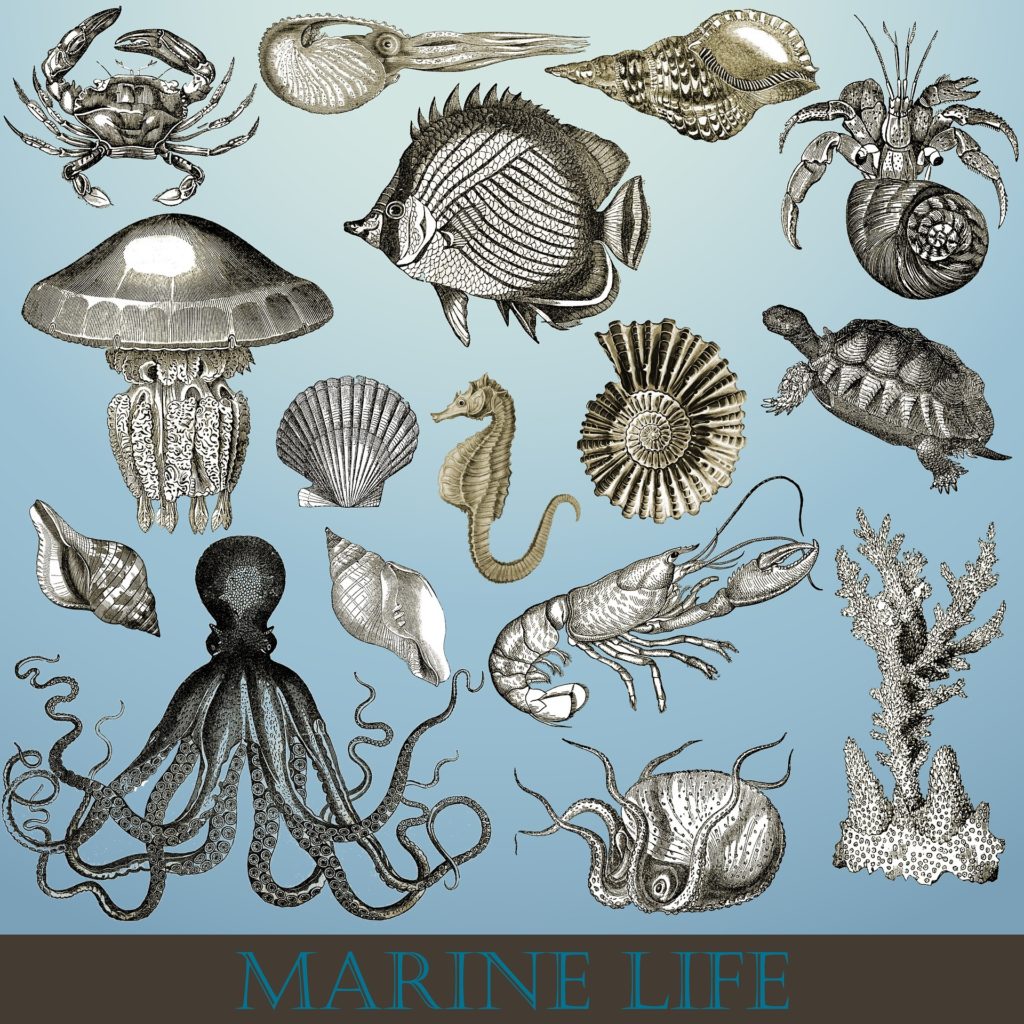"Zwanzigtausend Meilen unter den Meeren" von Jules Vernes (Auszug)
„XVIII Viertausend Meilen unter dem Pazifik
…
Ich machte mich wieder auf, um mich in meine Kabine zurückzuziehen. Da wandte sich Kapitän Nemo unvermittelt an mich.
„Herr Professor“, sagte er, „ist der Ozean nicht mit echtem Leben gesegnet? Kennt nicht auch er Zorn und Sanftmut? Gestern ist er eingeschlafen genau wie wir, und heute erwacht er nach einer ruhigen Nacht.“
Er hatte mich nicht einmal begrüßt. Setzte dieser rätselhafte Mann etwa ein Gespräch mit mir fort, das er zuvor schon im Geiste begonnen hatte?
„Sehen Sie nur“, sprach er weiter, „wie er sich unter den Liebkosungen der Sonne regt, durch sie sein tagtäglich neues Leben gewinnt. Seine Eigenheiten stellen für mich immer wieder einen interessanten Studiengegenstand dar. Er besitzt einen Puls, Arterien, er windet sich in Konvulsionen, und ich kann nur dem Gelehrten Maury beipflichten, der im Meer einen Kreislauf entdeckt hat, der ebenso tatsächlich vorhanden ist wie der Blutkreislauf von Tieren.“
Ich war mir sicher, dass Kapitän Nemo keine Antwort von mir erwartete, und es erschien mir unangebracht, ihm mit Floskeln zu kommen wie „stimmt“, „Sie haben recht“, „sehr richtig“. Er führte eher ein Selbstgespräch, das zwischen den Sätzen immer wieder von langem Schweigen unterbrochen wurde, eine Meditation, an der wir teilhaben durften.
„Ja, der Ozean besitzt einen echten Kreislauf, und um ihn zu schaffen, hat es nur genügt, dass der Schöpfer der Welt seine Wärmemenge erhöhte und das Salz und die Lebewesen dieses Elements vermehrte. Denn die Wärme ist die Verursacherin der unterschiedlichen Dichten, die dann Strömungen und Gegenströmungen verursachen. Die Verdunstung, in den Polarregionen gleich null, am Äquator dagegen sehr ausgeprägt, ist der Grund für einen ständigen Austausch zwischen tropischen und polaren Gewässern. Außerdem habe ich herausgefunden, was hinter den aufwärts und abwärts verlaufenden Strömungen steckt, die den Ozean gleichsam atmen lassen. Ich habe die Moleküle des Meerwassers erforscht: Sie erwärmen sich an der Oberfläche und sinken in die Tiefe hinab. Bei zwei Grad unter Null erreichen sie ihre größte Dichte; kühlen sie noch mehr ab, werden sie leichter und steigen wieder auf. An den Polen werden sie sich überzeugen können, welche Folgen dieses Phänomen hat, und begreifen, warum die umsichtige Natur alles so eingerichtet hat, dass der Vorgang des Gefrierens nur an der Wasseroberfläche stattfinden kann.“
Der letzte Satz Kapitän Nemos hatte mich aufhorchen lassen. Die Pole! Wollte dieser Mann, der keine Gefahr zu fürchten schien, uns etwa dorthin bringen?
Unterdessen war der Kapitän verstummt und betrachtete das Element, das er so eingehend und so unermüdlich erforscht hatte. Dann hob er wieder an:
„Im Meer ist eine beträchtliche Menge Salz gelöst, Herr Professor, und wenn man es dem Wasser entzöge, würde es einen Berg von viereinhalb Millionen Kubikmeilen bilden, der, über die Erde gleichmäßig verteilt, diese mit einer über zehn Meter hohen Schicht überziehen würde. Und denken Sie nicht, dass das Vorhandensein dieses Salzes etwa das Ergebnis einer Laune der Natur wäre. Durchaus nicht. Es verhindert die Verdunstungsneigung des Meerwassers und somit, dass die Winde zuviel feuchte Luft über die Landmassen treiben, was die Gefahr gewaltiger Regenfluten in den gemäßigten Zonen nach sich ziehen würde, wenn diese Feuchtigkeit sich entlädt. Das Salz spielt also eine immens wichtige Rolle im allgemeinen Haushalt des Erdballs, indem es eine mäßigende Funktion übernimmt.“
Kapitän Nemo hielt inne, blickte etwas auf und lief einige Schritte über die Plattform. Dann trat er wieder auf mich zu, um fortzufahren:
„Was die Aufgusstierchen betrifft, diese Millionen und Abermillionen von Kleinstlebewesen, die in einem einzigen kleinen Tropfen vorkommen und von denen achthunderttausend gerade ein Milligramm wiegen, so ist ihre Rolle nicht minder bedeutsam. Sie nehmen die Salze auf, werden so zu festen Bestandteilen des Wassers und bilden, indem sie sich zusammenschließen, Korallen und Madreporen, ja sie fügen sich sogar zu ganzen, aus Kalk bestehenden Kontinenten zusammen. Hat der Wassertropfen seine mineralische Komponente verloren, steigt er, leichter geworden, wieder an die Wasseroberfläche auf, nimmt dort die durch die allgemeine Verdunstung freigesetzten Salze auf, sinkt, nunmehr beschwert, erneut ab und zieht dabei die Substanzen mit sich in die Tiefe, welche wiederum von den Aufgusstierchen absorbiert werden. Daraus resultiert eine doppelte Strömung, eine ständige Auf- und Abbewegung, eben Leben, dessen Merkmale hier deutlicher ausgeprägt sind als auf dem Festland; dieses Leben ist praller, überbordender und äußert sich ständig in allen Schichten des Ozeans. Das Wasser, oft als Element des Todes für den Menschen bezeichnet, stelle ein Lebenselement für Myriaden von Tieren dar, und für mich ebenfalls.“
Während Kapitän Nemo diese Meditation vortrug, verklärte sich sein Gesicht.
„Hier existiert es, das wahre, das unverfälschte, das authentische Leben!“ fügte er hinzu. „Und deshalb schweben mir Bilder vor von Städten im Wasser, die ich gerne gründen würde, von unterseeischen Siedlungen, die, wie meine Nautilus, jeden Morgen auftauchen, um Luft zu schöpfen, freie Städte, keinem Joch unterworfen! Und wenn irgendein Despot es …“
Kapitän Nemo brach diesen letzten Satz mit einer heftigen Handbewegung ab. Dann wandte er sich direkt an mich, wie um einen unheilvollen Gedanken zu vertreiben.
„Monsieur Aronnax“, wollte er wissen, „wissen Sie, wie tief das Meer ist?“ …
Auszug aus Jules Vernes (….): „20 000 Meilen unter den Meeren“ , Neue ungekürzte Übersetzung von Martin Schoske, Seiten 203 – 206, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 1997, 2003, 2004. (mit sämtlichen Illustrationen der französischen Ausgabe von 1869 „Vingt mille lieues sous les mers“, erschienen im Verlag J. Hetzel et Cie. Paris).